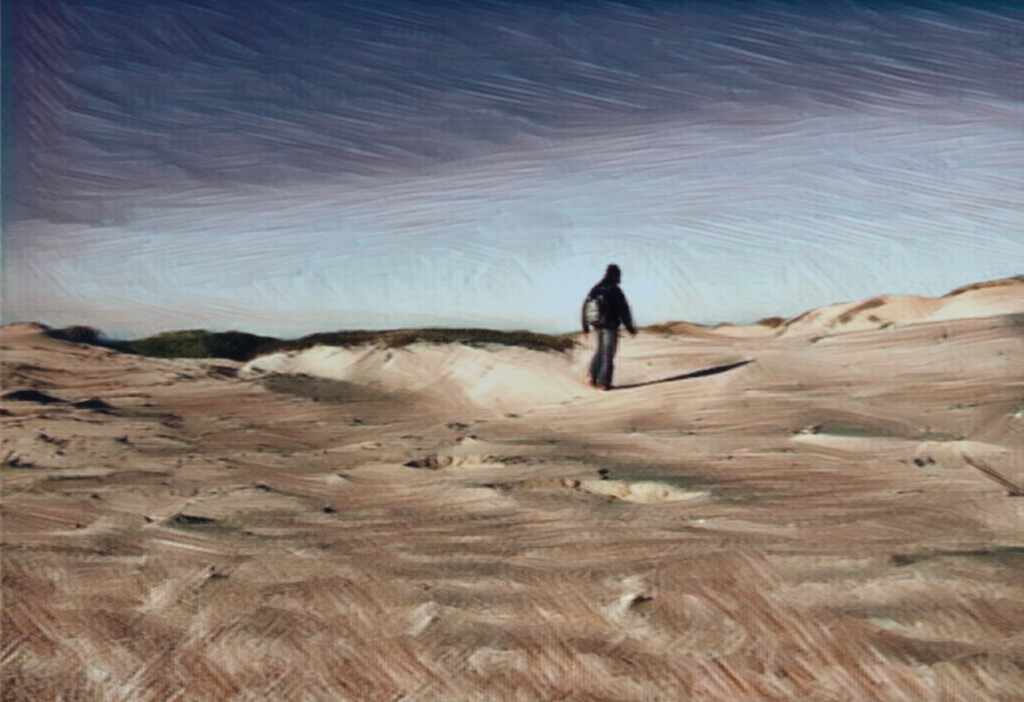Als die Flüchtlingswelle 2015 Deutschland erreichte, fühlte ich mich wieder an die Zeit erinnert, als wir Anfang der 90ger hierher zugewandert sind. Wie bei einem Perspektivwechsel konnten sich sicherlich auch andere sowjetischen Aussiedler, ostdeutsche Umsiedler, türkische und weitere Einwanderer ähnlich gefühlt haben: Du verlässt voraussichtlich für immer deine Heimat für einen Neuanfang und im Idealfall für ein besseres Leben!
Doch wenn Jemand sagt, dass der Grund bei der Suche einer neuen Heimat "ein besseres Leben" sein soll, dann wird diese Absicht nicht von allen genauso geteilt. Oft spielt es auch keine Rolle, ob du ein Aussiedler (hast deutsche Wurzeln) oder Ausländer (keine deutschen Wurzeln) bist. Du bist ein Fremder und triffst nun auf Menschen, die ihr Leben lang an diesem Ort leben oder seit einigen Jahren hier heimisch wurden. Hast du vor zu bleiben, musst du dir den Platz erst verdienen! Erst dann hast du die Chance akzeptiert und vielleicht sogar respektiert zu werden.
Erinnerungen bei Ankunft in Deutschland
Mich persönlich hat es zunächst etwas irritiert, als die ersten Flüchtlinge mit Blumen empfangen wurden. Denn ich selbst habe die Ankunft in Deutschland ganz anders in Erinnerung.
Mein früheres Heimatland war in Kirgisien und während der Reise von dort, haben wir irgendwo in der Zwischenfahrt eine alte Frau mitgenommen. Es war in unserer Familientradition üblich, dass man anderen Menschen helfen sollte. Deshalb haben wir die Verantwortung für diese alte Frau mit übernommen.
In Deutschland angekommen, landeten wir schließlich in einem Lager, wo der Empfang alles andere als freundlich war. So als wäre es erst gestern gewesen, kann ich mich noch gut an die Ereignisse erinnern. Direkt nach Ankunft mussten wir rennen, weil hinter uns ein für uns verantwortlicher Mann "Schneller! Schneller!" geschrien hat. Das war allerdings nicht ganz leicht. Die alte Frau konnte nicht so schnell laufen und wir mussten sie stützen, damit sie nicht hinfiel. Trotzdem hat es diesem Mann (oder wie ich ihn heute nenne: "Aufseher") scheinbar Spaß gemacht uns zu hetzen. Inzwischen mit der deutschen Geschichte vertraut, vergleiche ich heute diesen Ort mit einem Gefangenenlager, wo wir uns erst nicht sicher waren, ob wir am Ende des Tages überhaupt ein richtiges Dach über den Kopf haben werden.
Nur wenige Tage später sollte sich diese Befürchtung sogar bewahrheiten, als es für uns irgendwann hieß: "Es tut mir Leid, aber ich weiß nicht, wo ich Sie unterbringen kann". Nun haben wir also Jemanden gefunden, dem unsere Lage irgendwie Leid getan hat! Es war für uns also an der Zeit zu spüren, wie sich eine Obdachlosigkeit anfühlt. Völlig verzweifelt wussten wir erst nicht, was mit uns wird. Als für uns dann doch noch ein Platz in einer karitativen Einrichtung gefunden wurde, waren wir schließlich sehr erleichtert und konnten unser Glück kaum fassen.
Frage: Welches Land möchte dich schon haben?
Nun waren wir also Angekommen und das an einem Ort, wo wir immer wieder spüren sollten, dass so richtig erwünscht wir auch in diesem Land nicht sind.
Ohne zu weit vorzupreschen, möchte ich deshalb hier erst Eins nach dem Anderen genauer beleuchten:
Rückblickend und vor allem direkt nach unserer Ankunft haben wir schnell akzeptieren müssen, dass wir hier zu den Menschen einer untergeordneten Klasse gezählt werden. Eigentlich nicht ganz neu für uns. Denn in Kirgisien mussten wir ähnliche Erlebnisse durchmachen.
Es fing mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion an, was für uns eine Zeitenwende auslöste. Das Land stand nicht mehr länger in der primären Kontrolle Russlands und der überwiegende Teil der Kirgisen wollte uns am liebsten loswerden. Viele Kirgisen haben es dann regelrecht zu ihrer Aufgabe gemacht uns irgendwie aus dem Land zu drängen. Verdeutlicht haben sie es uns unter anderem damit, indem sie uns als die deutschen Faschisten bezeichneten. Gelang es ihnen nicht uns mit ihrer geschichtlichen Unkenntnis zu provozieren, griffen sie gerne auch mal zu anderen Mitteln, um uns das Leben so unangenehm wie möglich zu gestalten. Nun mussten wir uns davor hüten, was wir öffentlich aussprechen oder tun.
Anfang der Neunziger bekamen wir dann immer mehr das Gefühl, dass die Gesetze für die kirgisische Bevölkerung immer weniger galten. Und wenn das Recht kaum noch auf deiner Seite steht, wurde es für uns schnell gefährlich.
Einige Beispiele dazu: Als ich etwa 7 Jahre alt war, kann ich mich noch gut daran erinnern, wie ich und meine Schwester uns unter einem Tisch verstecken mussten, weil ein betrunkener kirgisischstämmiger Mann versucht hat in unser Haus einzudringen. Es war kein Geheimnis, dass sich eine Gruppe von Kirgisen abgesprochen haben, wer von ihnen welches Haus bekommen soll sobald wir verschwunden sind.
Die Zeit dort wurde für uns schließlich immer bedrohlicher. War ein kirgisischer Mann an einem (vermeintlichen) Unfall beteiligt, so konnte er sich mit kleinen Geldstrafen schnell wieder freikaufen. Für die Deutschen galt das nicht. Deshalb war für uns dann die Angst groß, dass wir bei leichten Regelverstößen (z.B. bei einer wehrhaften Aktion) ins Gefängnis kommen können, aus dem wir schließlich keinen Ausweg mehr finden. Schon allein um unser Überleben zu sichern, war es an der Zeit von dort zu fliehen.
Jetzt bist du angekommen. Nun finde dich damit ab!
Verglichen mit meinen Eltern habe ich als kleiner Junge im Großen und Ganzen die Zeit in Kirgisien nicht so schlimm empfunden. In meiner Erinnerung hatten wir dort eigentlich alles, was man so braucht. Außerdem hatte ich sehr viele Haustiere, die mir auch sehr am Herzen lagen. All das mussten wir nun dort zurücklassen. Wohl auch deshalb entwickelte ich in Deutschland ein großes Heimweh, an dem ich noch Jahre gelitten habe. Trotzdem war es mir bewusst, dass ein Zurück nicht mehr in Frage kommt!
In dem Caritas, wo wir untergebracht waren, gab es noch einige weitere Ankömmlinge, die aus verschiedenen Ländern gekommen sind und in Deutschland ihr Glück suchten. Doch kaum sind wir richtig angekommen, wurde ich direkt mit Gewalttaten unter den Kindern konfrontiert. Am liebsten wollte ich mich verteidigen, doch man hat es mir direkt untersagt zurück zu schlagen. Es hieß dann, sollte ich gegen Den oder Jeden meine Hand erheben, werden wir direkt wieder zurück nach Kirgistan ausgewiesen. Es hieß dann auch, dass die Familie XY, die ihre Rabauken großzieht, schon einmal dafür gesorgt hat, dass andere Ankömmlinge das Land verlassen mussten, weil sich ihre Kinder offenbar verteidigt haben (bzw. zurückgeschlagen haben). Nun musste ich mich also an ein neues Schicksal als Sandsack gewöhnen. Wie das neue Testament von einem guten Christen erwartet, musste ich nun auch meine andere Wange hinhalten, sobald ich eine Ohrfeige kassierte.
Woher kommst du nochmal?
Trotz all der Strapazen, war das Leben in Deutschland für uns bei weitem nicht so bedrohlich wie in Kirgisien. Denn in Kirgisien waren wir plötzlich zu den Fremden geworden und ein Leben wie bisher war da nicht mehr vorzustellen.
Während der Sowjetzeit war es jedoch ganz anders. Zum großen Glück hat ein ferner Verwandter ein Buch geschrieben mit dem Titel "Das Leben im Sturm der Zeit - (Orloff, 1891 - 1991)". In diesem Buch konnte ich sehr viel von der Entstehungsgeschichte meines ursprünglichen Dorfes "Orloff" und dem Leben meiner Verwandtschaft erfahren. Zum Beispiel stammt der Dorfname Orloff von einem gleichnamigen Dorf in Deutschland. Offenbar hat einer der Ur-Siedlern den Namen dort übernommen, was später dann nach russischem Standard "Orlowka" unbekannt wurde. Solche kleinen Dinge haben schließlich auch mein Leben ein Stück weit geprägt.
Doch was mir aus dem Buch auch in Erinnerung geblieben ist, war die Geschichte über die herangereifte Verbundenheit zwischen den deutschen Siedlern und den Kirgisen. Die Annäherung dieser eigentlich sehr unterschiedlichen Kulturen hat viel Zeit gebraucht. Im Buch ist sogar davon zu lesen, dass durch eine Hungersnot einige Deutsche ihre Essensrationen mit den Kirgisen geteilt haben. Offenbar löste das ein gegenseitiges Vertrauen aus und sie lebten dann lange in einer friedlichen Koexistenz.
Mit der zunehmenden Industrialisierung war es dann auch so, dass es kaum noch ein Unterschied machte, wer mit wem die Arbeit verrichtet hat. Lediglich die größeren leitenden Positionen mussten von Kirgisen besetzt sein. Sogar in den Schulen wurde Jeder gleich behandelt, nur studieren durften die Deutschen nicht in kirgisischen Hochschulen. Enge Beziehungen zwischen Deutschen und Kirgisen gab es allerdings kaum. Hier kann man unterschiedliche Gründe nennen (Religionen, Traditionen usw.).
Doch wie in jeder Zivilisation gab es auch da natürlich Ausnahmen. In den 60er bis Ende 80er Jahren, gab es dort laut meinen Eltern eine ziemlich harmonische Zeit und auch die besuchten Länder, wie Kasachstan und Russland standen offenbar ganz im Zeichen für mehr Toleranz. Zwar hörte man auch dort von Geschichten über Gewalttaten, doch diese waren eher unterrepräsentiert und konnten den Zusammenhalt der Menschen kaum trüben.
Wie kann es also sein, dass nach Zusammenbruch der Sowjetunion Plötzlich alle Gemeinsamkeiten oder Freundschaften, die sich über so lange Zeit entwickelt haben, nun nicht mehr galten?
Mehr dazu erfährt Ihr unserer dreiteiligen Reihe hier: Teil 2 / 3